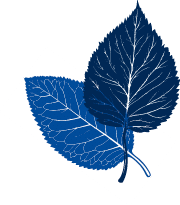Während sich die Welt wandelt, handeln wir und setzen Impulse — für Wald, Wasser, Klimaschutz und Artenvielfalt. Seit 1995 pflanzen wir mit vielen Unterstützenden Laubbäume — und damit Trinkwasser.

Wasser ist ein Menschenrecht
Sauberes Wasser, lebendige Wälder und Artenvielfalt für eine Welt, die auch kommenden Generationen ein lebenswertes Miteinander schenkt. Wir wissen, dass jede Spende, jede Pflanzung, jedes Engagement – egal wie klein es erscheinen mag – Teil eines großen Ganzen ist.
Für Laubbäume, die Wasser halten
Jeder Baum, den wir pflanzen, schlägt nicht nur Wurzeln in die Erde, sondern verändert das Trinkwasser auf dieser Erde. Ein Hektar unseres Trinkwasserwaldes sichert nach 10–15 Jahren den lebenslangen Trinkwasserbedarf für 800 Personen – und das jedes Jahr neu!
Achtsam & bewusst für morgen
Wertvolle Potenziale, die wir Menschen haben, und die uns helfen, den Wandel zukunftsfähig zu gestalten. Veränderung beginnt dort, wo Menschen verstehen, dass Wald und Wasser untrennbar miteinander verbunden sind, denn natürliche artenreiche Laubmischwälder sind Wassersammler, Wasserwerke und Wasserspeicher.
Gemeinsam für den Wandel
Jede*r von uns bringt einzigartige Expertise mit, doch uns eint die Mission, mit jedem Baum Zukunft zu pflanzen. Unterstützt werden wir bundesweit von Unternehmen und deren Mitarbeitenden, Förster*innen, Umweltpädagog*innen sowie Ehrenamtlichen — wir danken an dieser Stelle allen noch einmal sehr für das tolle Engagement!
Trinkwasserwald e.V. wurde für sein Engagement ausgezeichnet
- 2023 „Wir für morgen“-Preis der Union Asset Management Holding AG
- 2022 Nominierung für den Bundespreis „Blauer Kompass“ des Bundesumweltamtes
- 2019 Ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt
- 2016 Preisträger Sparda Bank Award
- 2014 Finalist im Deutschen Engagementpreis, Kategorie Publikumspreis
- 2012 Freyja-Scholing-Preis für Natur- und Umweltschutz
- 2011 Ehrenamtspreis der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung
- 2009 Preisträger Deutschland – Land der Ideen
- 2005 Umweltpreis der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung
Werden Sie Teil unserer Mission
Denn zusammen verwandeln wir nicht nur kahle Flächen in grüne Hoffnung – wir verwandeln die Welt, einen Baum nach dem anderen.